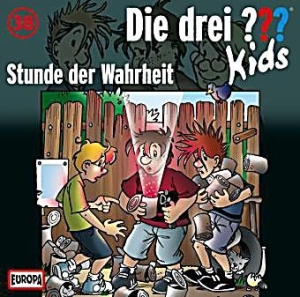Foto: Harry Hautumm / pixelio.de
Ebenfalls eine lange Tradition haben die beliebten Osterfeuer. Sie reichen bis in ur –und frühgeschichtliche Zeit zurück und entsprangen einer heidnisch-germanischen Sitte, wurden von den Römern übernommen und von der christlichen Kirche um der Popularität dieses Brauches willen reklamiert. Vor allem aber machen die Osterfeuer heutzutage den Beteiligten viel Spaß und fördern das Gemeinschaftsleben. Eine frühe Nachricht zum Osterfeuer gibt es aus der römischen Zeit. Der berühmte Kaiser Konstantin der Große, der sich kurz vor seinem Tode (337 n.Chr.) noch taufen ließ, veranstaltete jeweils in der Nacht vor Ostern gewaltige Freudenfeuer. Allerdings war dies kein christlicher Brauch, sondern dem Kaiser durch seine Truppen bekannt geworden, die im Grenzgebiet zum heidnischen Germanien stationiert waren. Dennoch betrachtete der Kaiser diese Feuer als einen besonderen Bestandteil des Osterfestes.
Die erste Nachricht aus christlichen Kreisen verdanken wir Bonifatius, der bei seinem Aufenthalt in Deutschland im Osterkult der Kirche das Osterfeuer (ignis pachalis) fand und offenbar wenig damit anfangen konnte. Daher hat er in einem Brief im Jahr 751 an Papst Zacharias (741 – 752) über diesen »deutschen« Brauch Hinweise erbeten, wie er sich dazu verhalten solle. Die Antwort der Curie machte deutlich, daß es sich um einen heidnischen Kult aus vorchristlicher Zeit handelte, der nur in abgewandelter Form von der deutschen Kirche übernommen worden sei. Aus weiteren Quellen, wie etwa von dem Helmarshäuser Benediktiner Conrad Fontanus aus dem 13. Jahrhundert, wissen wir, daß der Brauch des Osterfeuers vor allem in Norddeutschland, besonders in Niedersachsen und Westfalen, ausgeübt worden ist. Er berichtet aus Südhannover, auf dem Retberg zwischen Retberg und Wiebrechtshausen habe das Volk am Ostertag »mit der Sonnen Untergang noch bei Menschengedenken das Osterfeuer gehalten, welches die Alten Bockshorn geheißen«. Dieser ursprünglich heidnische Brauch feierte die Auferstehung der Natur, er sollte den Winter endgültig »zum Schmelzen« bringen und dem Frühling den Weg ebnen. Fröhlichkeit, Freude und Gesang waren damit verbunden, band sich doch später selbst die Kirche mit ihrem Auferstehungsfest in diesen Brauch ein. So überlieferte der Wolfenbütteler Schulrektor Reiskius 1696 einen anschaulichen Bericht: »Dahero noch heute zu Tage, sonderlich bei den Paptisten, am 1. Ostertage abends ein Feuer unter freiem Himmel von zusammengetragenem Holz bei großem Zulauf alter und junger Leute angezündet, ein deutsch oder lateinisch Lied dabei gesungen und endlich mit Ueberspringen die Lust so lange fortgesetzt wird, bis das Feuer nach verbranntem Gehölze ausgelöscht, darauf ein jedweder nach seinem Hause sich verfüget und einen Brand mit dahin einträget aus abergläubischer Meinung, es werde hierdurch vom Donnerwetter unbeschädigt und er nebst den Seinigen von schädlichen Feueranzündungen also bewahret sein«. Deutlich erfährt man, daß sich in der Neuzeit christlicher Brauch und heidnischer Aberglaube miteinander verbunden hatten.
Lange vor Ostern wurde das Holz gesammelt, denn im ganzen Land entwickelte sich sehr bald ein regelrechter Wettstreit zwischen den Dörfern um den größten »Osterberg« und das stärkste und hellste Osterfeuer. Zahlreiche und regional unterschiedliche Bräuche waren mit dem Osterfeuer verbunden, so das Tanzen, Springen, Singen, Fackelschwingen, Raketenschießen und Anschwärzen mit der Holzkohle des Feuers. Das Fackelschwingen war ein besonderer Brauch im Lande Braunschweig, während die übrigen Aktivitäten über ganz Norddeutschland verbreitet waren, aber stets waren mit dem Brauch des Osterfeuers Aberglaube und Hoffnungen verbunden.
So verband man mit dem Osterfeuer die Erwartungen, daß
– so weit das Licht der Feuer auf dem Land reichte, so weit sollten die Felder fruchtbar werden und reiche Ernte liefern.
Oder wenn:
– die Asche über das Feld verweht, soll diese die Fruchtbarkeit noch erhöhen und gleichzeitig Schädlingsbefall verhindern, vor allem den gefürchteten Mäusefraß.
Und:
– die Asche konnte auch im Trinkwasser für das Vieh aufgelöst werden und dann das Vieh vor Seuchen schützen.
Aber:
hell lodern sollten die Osterfeuer und weithin sichtbar sein, denn wenn Gebäude (auch in der Stadt) von Osterfeuern erhellt wurden, waren sie ein Jahr lang vor Feuer bewahrt und die Menschen sollten vor Krankheiten geschützt werden.
Es gab auch immer wieder Gegner des Brauchs. Obwohl sich nämlich die Kirche des ehemals heidnischen Brauches ebenfalls bediente, wie aus vielen Nachrichten und Quellen hervorgeht, gab es im Braunschweiger Land immer wieder besonders strenge Pastoren, die sogar von der Kanzel herab gegen die Osterfeuer predigten. Auch die staatliche Obrigkeit akzeptierte gelegentlich dieses uralte und landesweit verbreitete Brauchtum nicht immer: am 7. März 1647 verordnete Herzog August d. J., daß alle Feiertagsgelage, bei denen Knechte und Mägde gemeinsam feierten, tranken und tanzten, verboten seien, »ingleichen die Osterfeuer sollen ganz und gar abgeschaffet werden«.
Von der Obrigkeit zwar verboten, von den Menschen jedoch bis in die Gegenwart gepflegt, werden Jahr für Jahr die großen Osterfeuer angezündet, deren Licht Freude und das Ende des Winters, aber ebenso Hoffnung symbolisiert, vor allem Hoffnung auf Frieden.